-

Die Schulevon morgen
Welche Vorstellung haben Jugendliche von der Bildung der Zukunft? Was schätzen sie am heutigen System, und was muss aus ihrer Sicht dringend anders werden? Das zeigt unsere Fokusgruppenstudie. Wir haben den Studienleiter und eine Teilnehmerin getroffen.
Stell dir vor, du lebst im Jahr 2050. Deine Schulzeit liegt schon mehr als 20 Jahre zurück und seitdem hat sich einiges verändert: Zum Beispiel gehen Kinder nicht mehr jeden Tag in die Schule. „Ein komischer Gedanke“, findet Elif. Die 15-Jährige tippt ein paar Mal auf einem Tablet herum – schon fängt der kleine blaue Roboter vor ihr auf der Tischplatte an, sich im Kreis zu drehen und zu blinken.
Wenn Elif zum Jugendzentrum in ihrem Berliner Heimatviertel geht, beschäftigt sie sich immer wieder gerne mit dem kugeligen Bot. Dank ihm hat sie ihre Begeisterung für Technik entdeckt – und dank Betreuerin Stefanie Pfau, die mit den Jugendlichen programmieren übt oder andere spannende Aktionen unternimmt. Der Jugendclub ist eine zentrale Anlaufstelle für die Neuntklässlerin. Selbst nach einem anstrengenden Schultag kommt sie oft freiwillig hierhin. So wie heute nach der Englischarbeit. „Schule macht manchmal Spaß, aber nicht immer“, meint Elif. Im Jugendzentrum dagegen könne sie das tun, worauf sie Lust habe. Wäre eine Zukunft ohne Schule da nicht verlockend? Nein, das kann sich Elif nicht vorstellen. „Schule gehört für mich einfach dazu. Dort bringen uns die Lehrer wichtiges Wissen bei und sorgen dafür, dass sich alle weiterbilden.“

» Es war schön, dass wir den Erwachsenen sagen durften, was wir denken. «
Elif,
Teilnehmerin der FokusgruppenbefragungDrei Zukunftswelten
Die Schülerin einer integrierten Sekundarschule ist eine von 19 Jugendlichen, die das Fields Institute unter Leitung des Zukunfts- und Bildungsforschers Professor Gerhard de Haan im Frühjahr 2021 zu ihrer Vision der Bildung von morgen befragt hat. In einer ähnlich angelegten Untersuchung hatten die Wissenschaftler zuvor Hunderte Bildungsexperten zu dem Thema interviewt. „Wie aber sehen das die jungen Leute selbst? Erkenntnisse dazu gab es kaum“, berichtet de Haan.
Ermöglicht durch die Deutsche Telekom Stiftung brachte sein Team Schülerinnen und Schüler in fünf sogenannten Fokusgruppen zusammen. „Es war schön, dass wir den Erwachsenen sagen durften, was wir denken“, erinnert sich Elif. „Wir“ das sind Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands, aus bildungsnahen und bildungsfernen Haushalten.
Als Diskussionsgrundlage dienten ihnen drei Szenarien: Visionen, die de Haan und seine Kollegen auch für die Befragung der Erwachsenen genutzt hatten. „Mit diesen explorativen Szenarien bilden wir, angelehnt an große Trends, mögliche künftige Entwicklungen ab“, erklärt der Forscher. Szenario Nummer eins beschreibt eine Welt, in der Bildung nach wie vor rund um das klassische Schulsystem organisiert ist. Das zweite Szenario geht dagegen davon aus, dass Schule nur noch ein Teil einer komplexen Bildungslandschaft ist. Was gelernt werden soll, bekommen Kinder und Jugendliche an verschiedenen Orten vermittelt. Und in der dritten Zukunft spielt das Vor-Ort-Sein an einer Schule gar keine Rolle mehr, denn Bildung findet fast ausschließlich digital statt.
Auf die Schnelle: 1 Studie, 6 Fragen
Cookies von Drittanbietern sind deaktiviert. Bitte akzeptieren Sie die Cookies, um diesen Inhalt anzuzeigen.Gleicher Lernort, aber anders
Wie beurteilen die Schüler diese Zukunftswelten? Die Auswertung malt ein klares Bild: Genau wie Elif kann sich die Mehrheit der Befragten eine Welt ohne Schule kaum vorstellen. Sie bleibt zentraler Lernort, der wichtige Grundbildung vermittelt, für Bildungsgerechtigkeit sorgt, Halt und Orientierung bietet.
Trotzdem sind die Jugendlichen überzeugt, dass sich Schule wandeln muss. Was Elif ändern würde? „Die Schule soll nicht jeden Tag um 8 Uhr anfangen.“ Doch nicht nur die Taktung des Unterrichts stößt auf Kritik. Auch wenn es um Inhalte und die Art der Vermittlung geht, attestieren die jungen Menschen Reformbedarf. „Der klassische Fachunterricht ist nicht mehr zeitgemäß“, fasst de Haan zusammen. „Die Schüler haben mehr Spaß an Projekten, sie wünschen sich Alltagsbezug, Lehrkräfte, die individueller auf ihre Bedürfnisse eingehen, und mehr Mitspracherecht.“
Diese Form des Lernens verbindet Elif vor allem mit dem Jugendzentrum – ob beim Ausflug ins Museum oder beim Tüfteln mit Robotern. „Wir können hier viele tolle Sachen machen und mitbestimmen. In der Schule entscheiden immer nur die Lehrer“, sagt sie. Und noch etwas ist anders: „Ich kann mich Steffi und ihren Kollegen mit allem anvertrauen. Sie helfen mir bei Problemen und zeigen mir, wie ich mein Verhalten verbessern kann“, meint die Schülerin.
Ein Campus voller Möglichkeiten
Von der Vermittlung solcher überfachlichen Kompetenzen bis hin zu mehr lebenspraktischen Lerninhalten: All dies sind Dinge, die heute wichtig sind, um Kinder und Jugendliche auf die Zukunft vorzubereiten – da sind sich Experten einig. „Doch selbst Schulleitungen und Lehrkräfte sagen in Befragungen, dass Schule das alleine nicht leisten kann“, so de Haan.
Die Deutsche Telekom Stiftung unterstützt daher die Idee eines Bildungs-Ökosystems, in dem unterschiedliche Lernorte zusammenwirken. Auch viele Jugendliche entwickelten im Lauf der Diskussionen die Vorstellung einer Art Campus, auf dem sowohl klassische Einrichtungen wie die Schule als auch erfahrungsreiche Lernorte wie Bibliotheken und Makerspaces untergebracht sind. Digitale Lernwelten spielen nach Meinung der Befragten künftig ebenfalls eine wichtige Rolle. Einen rein virtuellen Unterricht wie während des Corona-Lockdowns wollen allerdings die wenigsten.
» Unsere Studien zeigen, dass wir alle in dieselbe Richtung wollen. Wer versucht, etwas zu bewegen, rennt offene Türen ein. «
Prof. Dr. Gerhard de Haan,
Studienleiter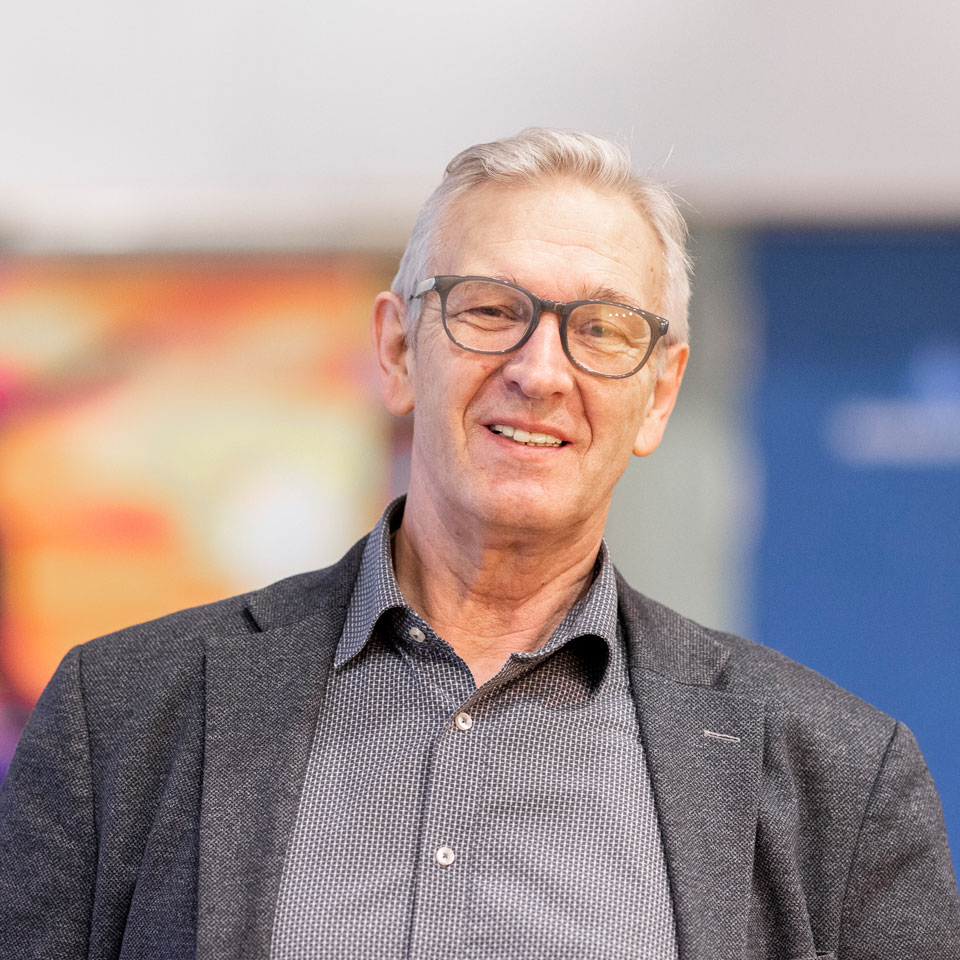
Gemeinsame Vision
Obwohl die Jugendlichen abhängig von ihrem soziokulturellen Hintergrund durchaus unterschiedliche Ansprüche an die Bildung der Zukunft stellen, so sind sie sich doch in entscheidenden Punkten erstaunlich einig – und stimmen auch mit den zuvor befragten Experten überein. „Schüler und Erwachsene teilen die Meinung, dass Schule reformiert werden muss“, sagt de Haan.
Wie solche Reformen gelingen könnten, zeige ein Blick in Länder wie Finnland oder Singapur, die schulische Bildung bereits neu denken. „Und auch in Deutschland gibt es ja einzelne Schulen, die innovative Konzepte umsetzen.“ Dass der große Wandel hierzulande schwerfällt, ist nach Ansicht de Haans auch kulturell bedingt: „Das Loslassen von Bekanntem liegt nicht unbedingt in unserer DNA. Auch wissenschaftlich nicht: Wir kennen mehr als 5.000 Institute in Deutschland, die sich mit Geschichte beschäftigen. Und vielleicht zehn, die sich mit Zukunftsfragen befassen.“
Trotzdem machten die Ergebnisse Mut: „Unsere Studien zeigen, dass wir alle in dieselbe Richtung wollen. Wer als Akteur wie die Telekom-Stiftung versucht, etwas zu bewegen, rennt im Prinzip offene Türen ein“, so de Haan. Etwas bewegen soll zum Beispiel das Stiftungsprojekt Werkstatt Neues Lernen. Hier arbeiten Lehrkräfte gemeinsam mit Akteuren außerschulischer Lernorte an Ideen für das Lernen und Lehren von morgen. Damit Elif im Jahr 2050 nicht sagen muss: Stell dir vor, es hat sich nichts verändert.
Lesen Sie auch …
Fotos und Videos: Marcel Kusch
© 2023 Deutsche Telekom Stiftung


